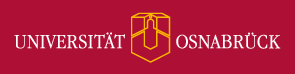Hauptinhalt
Topinformationen

Praxisphase GHR 300
Seit dem Wintersemester 2014/15 wurde in Niedersachsen für alle Studierenden der Lehrämter Grund, Haupt- und Realschule ein neues Konzept der universitären Lehrerausbildung eingeführt – die sogenannte "Praxisphase GHR 300“. Mit dieser wird intendiert, den Anteil von Praxisnähe, die Wissenschaftlichkeit und die Theorie-Praxis-Verknüpfung zu erhöhen und eine stärker berufsbezogene, kompetenzorientierte und forschungsbasierte Ausbildung zu realisieren. Seitdem besteht wie vorher der „Bachelor Bildung, Erziehung und Unterricht“ mit einer Regelstudienzeit von sechs Semestern und 180 Leistungspunkten. Der darauffolgende Master of Education wurde von zwei auf vier Semester verlängert, in denen die Studierenden der Studiengänge „Lehramt an Grundschulen“ und „Lehramt an Haupt- und Realschulen“ 120 Leistungspunkte erzielen. Insgesamt ergibt das 300 Leistungspunkte, woraus auch die Bezeichnung GHR 300 resultiert (GHR für Grund-, Haupt- und Realschule und 300 für 300 Leistungspunkte.)
Die Praxisphase erfolgt im Rahmen des Masterstudiums über drei Semester und zeichnet sich durch die Kooperation zwischen Schulen (Lehrer:innen), Studienseminaren (Fachseminarleiter:innen) und der Universität (Dozent:innen) aus. Die Studierenden nehmen an einem Vorbereitungs-, Begleit- und Nachbereitungsseminar in ihren beiden Studienfächern teil und an einem dreisemestrigen Forschungsseminar, das sie in einem ihrer beiden Fächer oder in dem erziehungswissenschaftlichen Bereich „Kerncurriculum Lehrerbildung“ absolvieren können. Der Praxisblock innerhalb der Praxisphase, d.h. der praktische Teil, erfolgt 18 Wochen (i.d.R. von Februar/März bis zum Beginn der niedersächsischen Sommerferien im Juli) an einer zugeteilten Schule, an der die Studierenden in beiden Fächern eine:n Tandempartner:in der Universität und eine:n Mentor:in der Schule zur Seite gestellt bekommt.
Das Projektband genannte Forschungsseminar steht unter einem Oberthema (z. B. Inklusion und Differenzierung im Textilunterricht). In wöchentlichen Seminarsitzungen erarbeiten die Studierenden die Forschungsgrundlagen. Dies bereitet die Studierenden darauf vor, am Ende des Seminars ein Forschungsprojekt zu entwickeln. Dieses Forschungsprojekt orientiert sich an der Schulpraxis der zukünftigen Lehrkraft. Im Praxisblock wird dieses Forschungsprojekt sodann im Handlungsfeld Schule durchgeführt. Die Begleitveranstaltungen des Projektbandes dienen zur Unterstützung. Nach der Datenerhebung in Form von Fragebögen, Interviews oder Beobachtungen innerhalb dieses Praxisblocks folgt die Datenauswertung während der Nachbereitung. Hierbei wird der Erkenntnisgewinn den Mitstudierenden und den Dozent:innen zugänglich gemacht.
Foto: Lucia Schwalenberg.
---